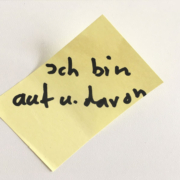Raus ins Grüne!
Laufen bedeutet für mich sehr viel. Es ist ein Gefühl von Leichtigkeit und der unbändige Drang nach Freiheit. Los lassen können, neue Orte erkunden und der Psyche eine Pause gönnen.
Von den ersten Runden im Karree bis zu den Wäldern und Bergen.
Aus gemütlichen Spaziergängen in der Nachbarschaft wurden lange Wanderstrecken durch Wälder, die mich immer wieder herausforderten. Wurzeln, Steine und ein ständiges Auf und Ab über Wald und Wiese. Ich legte schon immer einen großen Wert auf anspruchsvolle Wanderungen, die mich herausfordern, um daran zu wachsen. Jedoch hegte ich nie die Absicht in die Berge zu gehen. Erst als ein neuer Ehrenamtlicher bei mir anfing, riefen die Berge nach mir. Es warteten neue, spannende Hürden auf mich, die ich alleine nie in Angriff genommen hätte.
Kapitel 2: Der Berg ruft
Kaum hat Alex bei mir im Oktober 2021 angefangen, fassten wir unsere erste gemeinsame Bergwanderung ins Auge.
Wir brachen früh auf, denn bis nach Oberstdorf war es schon ein Stück zu fahren. Ziel: „Berggasthof in der Gaisalpe“. Weit oben in den Bergen verschlug es mir die Sprache, noch nie habe ich so frische Luft atmen können. Die gigantischen Bäume und der Blick nach oben in die Ferne überwältigten mich. Aber noch ein paar Worte zum Weg dorthin: Ich konnte mit der Assistenz gut mithalten, im Gegensatz zu meinen üblichen Strecken durch die Wälder forderte es viel mehr meine Konzentration, und meine Beinmuskeln hatten viel mehr zu schaffen. Auf dem Weg zum Gasthof ging es immer steiler bergauf. Der Untergrund wechselte von Betonboden zu matschigen Wiesen und Geröll. Doch bei der Gaststätte angekommen, wusste ich, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben. Wir pausierten gemeinsam mit anderen Wanderern auf einer Holzbank vor der Hütte und erfreuten uns an der strahlenden Sonne, die uns entgegenlächelte.
Eine holprige Marschstrecke lag vor uns.
Kapitel 3: Keine Zeit für Albernheiten
Hilfestellungen vom Assistenten sind beim Wandern je nach Begebenheit und Schweregrad der Strecke besonders wichtig.
Ich werde Euch anhand meiner ersten Wanderung etwas Einsicht schenken.
Der Rückweg war steinig und ich stolperte ziemlich unbeholfen den Weg entlang. Auf dem Hinweg hatte Alex seinen Arm um meinen Rücken gelegt und ich meinen Arm um seine Schulter platziert, damit er mich stützen und ich so besser mein Gleichgewicht halten konnte. Doch das blieb auf dem Rückweg aus, den Grund dafür kannte ich zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht. Stattdessen stützte ich mich an seiner Schulter ab. Doch mir war nicht ganz wohl bei diesem Teil der Wanderstrecke. Mein Gleichgewicht zu halten und dann noch mit meinem schlechten Sehvermögen zu wissen, wo ich welchen Fuß hinzusetzen habe, brachte mich ganz schön ins Schwitzen, und ich bin mehr als einmal über meine eigenen Füße gestolpert. Alex brachte mich aus einem guten Grund zum Schwitzen. Da dies unsere erste Wanderung gewesen ist, wollte er sehen, wo ich seine Unterstützung nötig habe und wie weit ich vorankomme, wenn er mir etwas weniger unter die Arme greift.
Menschen, denen ich auf meinen Wanderungen begegne, reagieren meist auf dieselbe Weise: hilfsbereit und lobend, dass ich trotz meiner Einschränkung die Strecke toll bewältigen würde. Die Sorte von Wanderern, die mir aber am besten gefällt, sind „die Plauderer“. Sie treten mit mir in einen normalen Austausch, bei dem es nicht um meine Einschränkungen geht.
Meine Fitness zu erhalten, ist die größte Motivation, solche Anstrengungen auf mich zu nehmen.